 Die
getreuen Nachbarn Die
getreuen Nachbarn
aus
Bad Grund |
 Bad
Grund (kip) Um 1700 lebten in Grund – im Grunde
sagte man damals – zwei Bergleute. Sie waren Nachbarn und hielten fest
zusammen. Sie hatten einen gemeinsamen Arbeitgeber und fuhren auch gemeinsam
in die Grube ein. Bad
Grund (kip) Um 1700 lebten in Grund – im Grunde
sagte man damals – zwei Bergleute. Sie waren Nachbarn und hielten fest
zusammen. Sie hatten einen gemeinsamen Arbeitgeber und fuhren auch gemeinsam
in die Grube ein.
 Ihr
Leben lang haben sie sich gegenseitig geholfen und als das vierzigste Lebensjahr
gekommen war, erkrankte der eine von diesen beiden Nachbarn. Es war Andreas
Kippenberg, der krank daniederlag – es hatte ihn in der Grube „aufgehudelt“.
Sein getreuer Nachbar Heinrich Lotze besuchte ihn täglich. Ihr
Leben lang haben sie sich gegenseitig geholfen und als das vierzigste Lebensjahr
gekommen war, erkrankte der eine von diesen beiden Nachbarn. Es war Andreas
Kippenberg, der krank daniederlag – es hatte ihn in der Grube „aufgehudelt“.
Sein getreuer Nachbar Heinrich Lotze besuchte ihn täglich.
 An
dem Tage, als Andreas Kippenberg starb, legte sich Heinrich Lotze aufs
Krankenbett. Er starb schon nach wenigen Stunden Krankenlager. An
dem Tage, als Andreas Kippenberg starb, legte sich Heinrich Lotze aufs
Krankenbett. Er starb schon nach wenigen Stunden Krankenlager.
 Damit
waren die getreuen Nachbarn nicht nur im Leben, sondern auch im Tod vereint. Damit
waren die getreuen Nachbarn nicht nur im Leben, sondern auch im Tod vereint.
Beide
getreue Nachbarn wurden am 12. August 1726 nach den Eintragungen im Kirchenbuch
nebeneinander beerdigt. |
|
|
|
|
|
 Das
Wappen der Bergstadt Bad Grund (Harz) Das
Wappen der Bergstadt Bad Grund (Harz)
- Eisen, Schlegel
und Löwen als Symbole -
 (kip)
Besondere
Urkunden über die Verleihung der Stadtrechte an die ehemals sieben
Oberharzer Bergstädte gibt es nicht. Die bergmännischen Siedlungen,
die seinerzeit sehr schnell entstanden, sind vom Landesherrn von Anfang
an als Bergstädte angesprochen worden. In den erlassenen Bergfreiheiten
des jeweiligen Landesfürsten sind sie als Bergstadt genannt und damit
bestätigt worden. (kip)
Besondere
Urkunden über die Verleihung der Stadtrechte an die ehemals sieben
Oberharzer Bergstädte gibt es nicht. Die bergmännischen Siedlungen,
die seinerzeit sehr schnell entstanden, sind vom Landesherrn von Anfang
an als Bergstädte angesprochen worden. In den erlassenen Bergfreiheiten
des jeweiligen Landesfürsten sind sie als Bergstadt genannt und damit
bestätigt worden.
Grund
erhielt im Jahre 1535 von Herzig Heinrich den Jüngeren (1514 - 1568),
zugleich im Namen seines Bruders Wilhelm, den er von 1523 - 1535 gefangen
hielt, die Stadtgerechtsame. Damit war auch das Recht verbunden, ein Wappen
zu führen.
Das
Wappen der Bergstadt Bad Grund ist mitten geteilt. Der obere Teil hat einen
schwarzen Hintergrund, während der untere Teil einen silbernen Hintergrund
hat. Auf dem schwarzen Teil ist ein Löwe mit roten Pranken und roter
Zunge sichtbar. Im unteren Teil ist das Emblem des Bergbaus, Schlegel und
Eisen abgebildet. Schlegel und Eisen sind schwarz, die Stiele dagegen braun.
Das Wappenschild wird von einem dahinter stehenden goldenen Löwen,
dessen Kopf mit Krone dem Betrachter zugewandt ist, mit den Vorderpranken
gehalten.
 Das
Wappen der Bergstadt Bad Grund finden wir auch im Stadtsiegel wieder. Zunächst
mag durchaus unklar sein, warum ein Löwe im Wappen abgebildet ist
und ein weiterer Löwe das Wappenschild hält. Das
Wappen der Bergstadt Bad Grund finden wir auch im Stadtsiegel wieder. Zunächst
mag durchaus unklar sein, warum ein Löwe im Wappen abgebildet ist
und ein weiterer Löwe das Wappenschild hält.
Wie
wir von den Schützenfesten in Badenhausen, Gittelde und Windhausen
wissen, spielt der Löwe als Preis für den besten Schützen
eine besondere Rolle. Herzogin Elisabeth zu Braunschweig und Lüneburg
stiftete für das jeweilige Schützenfest, das früher -als
Grund noch ein Ortsteil von Gittelde war - abwechselnd in Bad Grund und
in Gittelde stattfand, als wertvollen Preis einen Löwen aus Silber.
Dieses Ehrenzeichen wird noch heute vom Schützenkönig an einer
Halskette in Badenhausen, Gittelde und Windhausen getragen.
 Dieser
Siegerpreis der Schützen könnte der Grund sein, daß der
Löwe im Wappen der Bergstadt aufgenommen wurde. Es könnte aber
auch sein, daß damit die Verbundenheit der Bergstadt zum Herzogtum
Ausdruck verliehen werden sollte. Dieser
Siegerpreis der Schützen könnte der Grund sein, daß der
Löwe im Wappen der Bergstadt aufgenommen wurde. Es könnte aber
auch sein, daß damit die Verbundenheit der Bergstadt zum Herzogtum
Ausdruck verliehen werden sollte.
Eisen
und Schlegel sind Hinweise auf die seit Jahrhunderten bedeutendste Einkunftsart
der Bergstadt, dem Bergbau, der wohl leider endgültig im März
1992 in Bad Grund und damit im Harz zu Ende ging.
Unser
Foto zeigt das Wappen, das über der Eingangstür des ehemaligen
Rathauses der Bergstadt Bad Grund angebracht ist. |

1855 2005 2005
Kurort
Bad Grund kann 2005 auf eine 150-jährige Geschichte zurückblicken |
Vor
150 Jahren wurde Bad Grund als Kurort gegründet. Nach alten Überlieferungen
sollen schon 1510 die ersten Bäder in Bad Grund verabreicht sein.
Die verwitwete Herzogin Elisabeth von Braunschweig-Lüneburg geborene
Gräfin von Stolberg, die auf der nahegelegenen Stauffenburg lebte
und die Bergstadt Bad Grund oftmals besuchte, hat 1510 in Bad Grund Schlackenbäder
genommen. Ein prächtiges Glasgemälde im Atrium (Haus des Gastes)
erinnert an diesen Ursprung des Bade- und Kurortes. Dieser ihrer Handlung
wurde seinerzeit keine besondere Bedeutung beigemessen
 Bad Grund (kip) Erst 1855 reihte sich die Bergstadt
Grund in die Reihe der Kurorte ein. Der Berg- und Stadtphysikus Dr. Karl
Heinricht Brockmann aus der benachbarten Bergstadt Clausthal, der Grundner
Bergapotheker Karl Hermann August Helmkampff und der Rathauswirt Wilhelm
Römer aus Grund legten am 1. Mai 1855 den Grundstein für den
Bade- und Kurort Grund.
Bad Grund (kip) Erst 1855 reihte sich die Bergstadt
Grund in die Reihe der Kurorte ein. Der Berg- und Stadtphysikus Dr. Karl
Heinricht Brockmann aus der benachbarten Bergstadt Clausthal, der Grundner
Bergapotheker Karl Hermann August Helmkampff und der Rathauswirt Wilhelm
Römer aus Grund legten am 1. Mai 1855 den Grundstein für den
Bade- und Kurort Grund.
 Zu
dieser Zeit lebten etwa 1540 Einwohner in Grund und Eisenerz wurde am Iberg
abgebaut und in Eisenhütten - überwiegend im Bereich des heutigen
Hübichweges - geschmolzen. Zu
dieser Zeit lebten etwa 1540 Einwohner in Grund und Eisenerz wurde am Iberg
abgebaut und in Eisenhütten - überwiegend im Bereich des heutigen
Hübichweges - geschmolzen.
 Dr.
Brockmann erkannte, dass das Harzstädtchen Grund durch seine Lage,
von hohen Bergen mit Wiesen und Wäldern umgeben, als Kurort geeignet
sei, Kranke wieder gesunden zu lassen. Dr.
Brockmann erkannte, dass das Harzstädtchen Grund durch seine Lage,
von hohen Bergen mit Wiesen und Wäldern umgeben, als Kurort geeignet
sei, Kranke wieder gesunden zu lassen.
Sein
Bericht an die Königliche Regierung in Hannover wurde positiv aufgenommen.
Der Bergapotheker Karl Hermann August Helmkampff errichtete die erste Kurbadeanstalt
in Grund, die am 1. Mai 1855 eröffnet wurde.
 Der
Wirt Wilhelm Römer fand sich bereit, ein Gasthaus zur Aufnahme von
Kurgästen einzurichten und für deren leibliches Wohl zu sorgen. Der
Wirt Wilhelm Römer fand sich bereit, ein Gasthaus zur Aufnahme von
Kurgästen einzurichten und für deren leibliches Wohl zu sorgen. |
 Im
Helmkampffschen Badehaus wurden aus Fichtentriebe gewonnene Extrakte zu
Wannen- und Dampfbädern und das Fichtennadelöl zu Inhalationskuren
verwendet. Es wurden Fichtennadeldampfbäder angeboten. Weiter wurde
Molke aus der ausgezeichneten Kuh- und Ziegenmilch der Bergstadtherden
nach Appenzeller Art bereitet und in der Badenanstalt verabreicht. Im
Helmkampffschen Badehaus wurden aus Fichtentriebe gewonnene Extrakte zu
Wannen- und Dampfbädern und das Fichtennadelöl zu Inhalationskuren
verwendet. Es wurden Fichtennadeldampfbäder angeboten. Weiter wurde
Molke aus der ausgezeichneten Kuh- und Ziegenmilch der Bergstadtherden
nach Appenzeller Art bereitet und in der Badenanstalt verabreicht.
 Erst
1870/71 ließ sich in Bad Grund der erste praktische Arzt Dr. med.
Freymuth nieder, der bis 1894 praktizierte. Erst
1870/71 ließ sich in Bad Grund der erste praktische Arzt Dr. med.
Freymuth nieder, der bis 1894 praktizierte.
 An
die Gründung des Kurortes Grund am 1. Mai 1855 erinnert ein Schild,
das am Gebäude der ehemaligen Apotheke - heute Straße An der
Post - neben dem Hotel „Römer“ angebracht ist. An
die Gründung des Kurortes Grund am 1. Mai 1855 erinnert ein Schild,
das am Gebäude der ehemaligen Apotheke - heute Straße An der
Post - neben dem Hotel „Römer“ angebracht ist.
 Die
steten Bemühungen um den Gast blieben nicht aus. Im Jahre 1955 zählte
die Städt. Kurverwaltung 12 744 Kurgäste mit 202 026 Übernachtungen.
In 2004 wurden rund 10.200 Gäste mit rund 60 000 Übernachtungen. Die
steten Bemühungen um den Gast blieben nicht aus. Im Jahre 1955 zählte
die Städt. Kurverwaltung 12 744 Kurgäste mit 202 026 Übernachtungen.
In 2004 wurden rund 10.200 Gäste mit rund 60 000 Übernachtungen.
Die
Gründung des Kurortes Bad Grund vor 150 Jahren dürfte Anlass
genug sein, dieses Jubiläum würdig zu feiern, zumal unsere Vorvorderen
die Jubliäen stets ausgiebig gefeiert haben. |
|
| Er
nannte seine Gaststätte „Römers Hotel Rathaus“ (Farbbild oben).
Der erste Kurgast war Major von Brandenstein mit seiner Gemahlin aus Hannover.
Reiche Adelsfamilien folgten seinem Aufenthalt. |
|
Daran
erinnert beispielsweise der Kurort-Gedenkstein am Hübichweg gegenüber
dem Haus des ehemaligen Fuhrherrn Kippenberg. |
Unsere
Foto zeigen die ehemalige Apotheke „An der Post“ Anno Dazumal und heute |
Winfried
Kippenberg
|

|
Kirchengemeinde
St. Antonius feiert 500-jähriges Bestehen
|
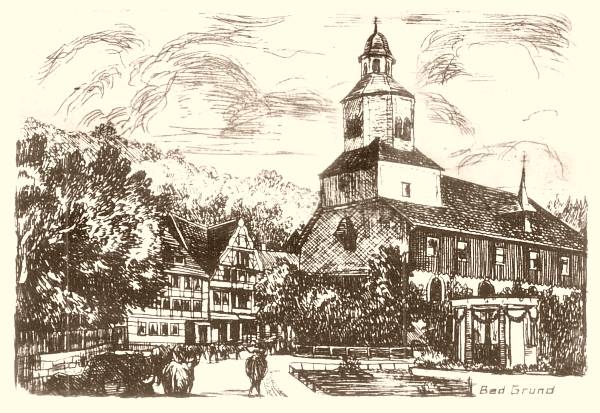 In
Jahr 2005 kann die Kirchengemeinde Bad Grund „St. Antonius“ auf ihr 500-jähriges
Bestehen zurückblicken. 1505 wurde sie vom „Filial“ der Mutterkirche
Gittelde selbständige Pfarrkirche. In
Jahr 2005 kann die Kirchengemeinde Bad Grund „St. Antonius“ auf ihr 500-jähriges
Bestehen zurückblicken. 1505 wurde sie vom „Filial“ der Mutterkirche
Gittelde selbständige Pfarrkirche.
 Die
Geburtsstunde der Kirchengemeinde „St. Antonius“ „Gittel im Grunde“ geschah
am 29. Juni 1505, dem Tage der Apostel Petrus und Paulus. An diesem Tag
erhob die auf der nahegelegenen Stauffenburg regierende und allseits geschätzte
Herzogin Elisabeth von Braunschweig-Lüneburg geborene Gräfin
von Stolberg durch eine eigenhändig unterzeichnete Fundationsurkunde
die Antoniuskapelle zur selbständigen Pfarrkirche. Diese Jubiläum
soll am letzten Wochenende im Juni 2005 mit einem Kirchenfest gefeiert
werden. Die
Geburtsstunde der Kirchengemeinde „St. Antonius“ „Gittel im Grunde“ geschah
am 29. Juni 1505, dem Tage der Apostel Petrus und Paulus. An diesem Tag
erhob die auf der nahegelegenen Stauffenburg regierende und allseits geschätzte
Herzogin Elisabeth von Braunschweig-Lüneburg geborene Gräfin
von Stolberg durch eine eigenhändig unterzeichnete Fundationsurkunde
die Antoniuskapelle zur selbständigen Pfarrkirche. Diese Jubiläum
soll am letzten Wochenende im Juni 2005 mit einem Kirchenfest gefeiert
werden.
 Bad
Grund (kip) Die verwitwete Herzogin Elisabeth,
die 1495 die Stauffenburg als Leibgedinge erhielt, förderte den Ort
„Gittel im Grunde“, so wie Bad Grund damals genannt wurde. Sie hat seinerzeit
Schlackenbäder genommen haben und den Iberger Bergbau in Grund wesentlich
gefördert und ausgebaut. Mit ihrer Unterstützung entstehen zahlreiche
Eisenhütten und Stahlschmieden in der Bergstadt Bad Grund. Bad
Grund (kip) Die verwitwete Herzogin Elisabeth,
die 1495 die Stauffenburg als Leibgedinge erhielt, förderte den Ort
„Gittel im Grunde“, so wie Bad Grund damals genannt wurde. Sie hat seinerzeit
Schlackenbäder genommen haben und den Iberger Bergbau in Grund wesentlich
gefördert und ausgebaut. Mit ihrer Unterstützung entstehen zahlreiche
Eisenhütten und Stahlschmieden in der Bergstadt Bad Grund.
 Ihr
zu Ehren wurde die am Kurpark verlaufene Straße benannt. An ihr Wirken
erinnert im Atrium (Haus des Gastes) an der stadtseits gelegenen Fensterfront
ein Glasgemälde und der historische Holzwegweiser auf dem Marktplatz. Ihr
zu Ehren wurde die am Kurpark verlaufene Straße benannt. An ihr Wirken
erinnert im Atrium (Haus des Gastes) an der stadtseits gelegenen Fensterfront
ein Glasgemälde und der historische Holzwegweiser auf dem Marktplatz.

|
Die
Grundner Kirchengemeinde, die die Bezeichnung „Gittel im Grunde“ führte,
war Teil der Kirchengemeinde Gittelde. Der Flecken Gittelde weist zwei
Kirchen auf. Beide Kirchen können auf eine über 1000-jährige
Geschichte zurückblicken. Sie dürfen über das 10. Jahrhundert
zurückreichen.
 Die
zu Ehren des Evangelisten Johannes geweihte untere Gittelder Kirche dürfte
schon im 9. Jahrhundert gegründet sein. Sie entstand als Kapelle des
Billunger-Kaiserhofes. Im 13. Jahrhundert nennt sie der Gittelder Pfarrer
ausdrücklich Kapellan des Kaiserhofes; er zieht es sogar vor, diese
Bezeichnung dem Titel „Pfarrer in Gittelde“ voranzustellen. Das Bistum
Mainz erhob diese Kirche zur Pfarrkirche. Die
zu Ehren des Evangelisten Johannes geweihte untere Gittelder Kirche dürfte
schon im 9. Jahrhundert gegründet sein. Sie entstand als Kapelle des
Billunger-Kaiserhofes. Im 13. Jahrhundert nennt sie der Gittelder Pfarrer
ausdrücklich Kapellan des Kaiserhofes; er zieht es sogar vor, diese
Bezeichnung dem Titel „Pfarrer in Gittelde“ voranzustellen. Das Bistum
Mainz erhob diese Kirche zur Pfarrkirche. |
  Der
Landbesitz beider Kirchen lag bezeichenenderweise im Mittelalter überwiegend
nicht in Gittelde, sondern im Raum Seesen-Dannhausen. Ausgangs des Mittelalters
war die Mauritus-Kirche die bedeutendere der beiden Gittelder Kirchen.
Dies ist bis heute so geblieben. Der
Landbesitz beider Kirchen lag bezeichenenderweise im Mittelalter überwiegend
nicht in Gittelde, sondern im Raum Seesen-Dannhausen. Ausgangs des Mittelalters
war die Mauritus-Kirche die bedeutendere der beiden Gittelder Kirchen.
Dies ist bis heute so geblieben.
 Beide
Kirchen waren bereits im hohen Mittelalter Pfarrkirchen und hatten „Filialen“.
Zur Johanneskirche gehörte im Mittelalter das Dorf Windhausen und
seit 1655 die Tochterkirche Badenhausen. Während die Badenhäuser
Kirche dem Heiligen St. Martin geweiht ist, trägt die Windhäuser
Kirche den Namen St. Johannis. Beide
Kirchen waren bereits im hohen Mittelalter Pfarrkirchen und hatten „Filialen“.
Zur Johanneskirche gehörte im Mittelalter das Dorf Windhausen und
seit 1655 die Tochterkirche Badenhausen. Während die Badenhäuser
Kirche dem Heiligen St. Martin geweiht ist, trägt die Windhäuser
Kirche den Namen St. Johannis.
 Ein
noch heute in der Johannes-Kirche vorhandener gotischer Flügelaltar
dürfte sicher der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts zuzuordnen
sein. Ein
noch heute in der Johannes-Kirche vorhandener gotischer Flügelaltar
dürfte sicher der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts zuzuordnen
sein.
Die
obere, dem Märtyrer Mauritius geweihte Kirche ist erst nach der Übertragung
der Markt- und Münzrechte an das Bistum Magdeburg entstanden. Die
Stiftskirche in Magdeburg ist ebenfalls dem Heiligen Mauritius geweiht.
Die Mauritiuskirche in Gittelde muss wohl auch als magdeburgische Enklave
innerhalb der sonstigen Zuständigkeit des Bistums Mainz anzusehen
sein.
 Die
Mauritiuskirche war bis 1505 „Mutterkirche“ der Antoniuskapelle in Grund,
die um 1465 durch den Hüttenbesitzer Hans Streit erbaut wurde. Der
Erhebung dieser Kapelle zur Pfarrkirche mit Renten und Grundstücken
am 29. Juni 1505 stimmte Burchard von Gadenstedt, Patronatsherr der Gittelder
Kirche, und der Gittelder Pfarrer Johann Köler zu. Zu der Ausstattung
der Grundner Kirche hat neben Hüttenbesitzer Streit höchstwahrscheinlich
auch die Mauritiuskirche beigetragen. Weil 1505 schon eine Antoniuskapelle
in „Gittel im Grunde“ (in Bad Grund) bestand, kann daher die Ev.-luth.
Kirchengemeinde Bad Grund zugleich auch das Fest „500 Jahre St. Antoniuskirche“
am 26. Juni 2005 mit Stolz feiern. Die
Mauritiuskirche war bis 1505 „Mutterkirche“ der Antoniuskapelle in Grund,
die um 1465 durch den Hüttenbesitzer Hans Streit erbaut wurde. Der
Erhebung dieser Kapelle zur Pfarrkirche mit Renten und Grundstücken
am 29. Juni 1505 stimmte Burchard von Gadenstedt, Patronatsherr der Gittelder
Kirche, und der Gittelder Pfarrer Johann Köler zu. Zu der Ausstattung
der Grundner Kirche hat neben Hüttenbesitzer Streit höchstwahrscheinlich
auch die Mauritiuskirche beigetragen. Weil 1505 schon eine Antoniuskapelle
in „Gittel im Grunde“ (in Bad Grund) bestand, kann daher die Ev.-luth.
Kirchengemeinde Bad Grund zugleich auch das Fest „500 Jahre St. Antoniuskirche“
am 26. Juni 2005 mit Stolz feiern. |
|
Kirchenglocken
der St. Antoniuskirche müssen erneuert werden
|
– Kirchengemeinde
richtete Spendenkonto ein –
 Bad
Grund (kip) Zwei der drei Kirchenglocken der St. Antoniuskirche in
Bad Grund müssen erneuert werden. Dies war das Ergebnis der Untersuchungen
des Glockensachverständigen der Landeskirche. Zwei der Kirchenglocken
sind Eisenglocken, die nach dem II. Weltkrieg gegossen wurden und seitdem
zu gottesdienstlichen Feiern läuteten. Diese Eisenglocken haben nur
eine begrenzte Haltbarkeit. Bad
Grund (kip) Zwei der drei Kirchenglocken der St. Antoniuskirche in
Bad Grund müssen erneuert werden. Dies war das Ergebnis der Untersuchungen
des Glockensachverständigen der Landeskirche. Zwei der Kirchenglocken
sind Eisenglocken, die nach dem II. Weltkrieg gegossen wurden und seitdem
zu gottesdienstlichen Feiern läuteten. Diese Eisenglocken haben nur
eine begrenzte Haltbarkeit.
 Nach
gut 50 Jahren müssen diese Eisenglocken ersetzt werden. Eine Reparatur
ist nicht möglich. Eisenglocken lassen sich nicht reparieren. Aus
diesem Grunde läuten diese Glocken immer seltener, um deren Einsatzdauer
für eine kurze begrenzte Zeit hinauszuzögern. Der Glockensachverständige
der Landeskirche hat festgestellt, dass diese Eisenglocken nur noch höchstens
ein bis zwei Jahre läuten können. Es steht die große Gefahr,
dass die Glocken auseinanderbrechen und schwere Zerstörungen im Turm
anrichten können. Nach
gut 50 Jahren müssen diese Eisenglocken ersetzt werden. Eine Reparatur
ist nicht möglich. Eisenglocken lassen sich nicht reparieren. Aus
diesem Grunde läuten diese Glocken immer seltener, um deren Einsatzdauer
für eine kurze begrenzte Zeit hinauszuzögern. Der Glockensachverständige
der Landeskirche hat festgestellt, dass diese Eisenglocken nur noch höchstens
ein bis zwei Jahre läuten können. Es steht die große Gefahr,
dass die Glocken auseinanderbrechen und schwere Zerstörungen im Turm
anrichten können.
 Die
Kirchengemeinde „St. Antonius“ möchte diese beanstandeten Eisenglocken
schnellstmöglich durch zwei neue Bronze-Glocken ersetzen. Gleichzeitig
sollte der Glockenturm erneuert werden. Die
Kirchengemeinde „St. Antonius“ möchte diese beanstandeten Eisenglocken
schnellstmöglich durch zwei neue Bronze-Glocken ersetzen. Gleichzeitig
sollte der Glockenturm erneuert werden. |
 Mit
Kosten von 25 bis 30.000 Euro muss gerechnet werden. Mit Zuschüssen
von der Landeskirche wird die Grundner Kirchengemeinde kaum rechnen können.
Dennoch wurde ein entsprechender Antrag auf Fördermittel gestellt. Mit
Kosten von 25 bis 30.000 Euro muss gerechnet werden. Mit Zuschüssen
von der Landeskirche wird die Grundner Kirchengemeinde kaum rechnen können.
Dennoch wurde ein entsprechender Antrag auf Fördermittel gestellt.
 Wünschenswert
wäre es, wenn mit der Feier „500 Jahre St. Antoniuskirche als selbständige
Pfarrkirche“ am 26. Juni 2005 auch die neuen Bronze-Glocken zu diesem besonderen
Kirchenfest läuten könnten. Pastor Klaus Lehmberg: „Wir sind
nahezu auf uns selbst gestellt. Aus diesem Grunde bittet die Ev.-luth.
Kirchengemeinde um Spenden für die neuen Glocken und einen neuen Glockenturm.
Die Resonanz für Spenden ist gut. Dafür sei er sehr dankbar.
Die Kirchengemeinde hat dafür ein Spendenkonto eingerichtet.“ Wünschenswert
wäre es, wenn mit der Feier „500 Jahre St. Antoniuskirche als selbständige
Pfarrkirche“ am 26. Juni 2005 auch die neuen Bronze-Glocken zu diesem besonderen
Kirchenfest läuten könnten. Pastor Klaus Lehmberg: „Wir sind
nahezu auf uns selbst gestellt. Aus diesem Grunde bittet die Ev.-luth.
Kirchengemeinde um Spenden für die neuen Glocken und einen neuen Glockenturm.
Die Resonanz für Spenden ist gut. Dafür sei er sehr dankbar.
Die Kirchengemeinde hat dafür ein Spendenkonto eingerichtet.“
 Spenden
für die Kirchenglocken können auf das Spendenkonto eingezahlt
werden, das bei der Volksbank Oberharz Kontonummer 1667501 BLZ 26361299
eingerichtet wurde. Spenden
für die Kirchenglocken können auf das Spendenkonto eingezahlt
werden, das bei der Volksbank Oberharz Kontonummer 1667501 BLZ 26361299
eingerichtet wurde.
 Pastor
Klaus Lehmberg: „Jeder Euro hilft uns, dem Ziel der Anschaffung neuer
Bronzen-Glocken näher zu kommen.“ Pastor
Klaus Lehmberg: „Jeder Euro hilft uns, dem Ziel der Anschaffung neuer
Bronzen-Glocken näher zu kommen.“ |
|
|

